Im Jahr 2025 ist der digitale Bauantrag kein Zukunftstraum mehr - er ist Realität. Doch wer glaubt, dass alle Bundesländer denselben Weg gehen, irrt. Die Digitalisierung der Baugenehmigungsverfahren in Deutschland ist kein einheitlicher Prozess, sondern ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Lösungen, Geschwindigkeiten und Erfolgen. Ob du als Bauherr, Architekt oder Ingenieur einen Antrag stellst, hängt stark davon ab, in welchem Bundesland du baust. In einigen Regionen läuft alles online, nahtlos und schnell. In anderen musst du immer noch Papierformulare ausdrucken, unterschreiben und per Post schicken. Warum das so ist und wie du dich am besten zurechtfindest, erklären wir dir hier.
Was ist der digitale Bauantrag wirklich?
Der digitale Bauantrag ist die technische Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes (OZG) im Bereich Bauen und Wohnen. Er soll das jährlich rund 200.000 Mal vorkommende Verfahren zur Baugenehmigung schneller, transparenter und weniger bürokratisch machen. Statt mehrere Behörden mit Papierakten zu belasten, wird alles über ein zentrales Portal elektronisch eingereicht - von den Bauplänen bis zur Statik-Berechnung. Der Standard dafür heißt XBau: ein bundesweit einheitliches XML-Format, das alle relevanten Daten strukturiert überträgt. Das bedeutet: Ein Planer in Stuttgart kann dieselben Dateien verwenden wie einer in Kiel - wenn die Behörde sie annimmt.
Die technische Basis wurde 2021 in Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Dort startete das erste „Einer-für-Alle“-Projekt (EfA), das andere Bundesländer einfach übernehmen konnten. Die Infrastruktur wird vom DVZ Mecklenburg-Vorpommern betrieben, 150 Bauämter nutzen es bereits. Bis September 2025 wurden fast 45.000 digitale Anträge gestellt - das sind durchschnittlich 3.750 pro Monat. Noch ist das nur ein Bruchteil der Gesamtmenge, aber der Trend ist klar: Die Zahl steigt quartalsweise um 18 Prozent.
Wer nutzt die zentrale Lösung - und wer nicht?
Die große Mehrheit der Bundesländer hat sich für die EfA-Lösung aus Mecklenburg-Vorpommern entschieden: 13 von 16. Dazu gehören Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Bremen, Baden-Württemberg und eben Mecklenburg-Vorpommern selbst.
Aber es gibt drei Ausnahmen: Berlin, Brandenburg und Hessen. Sie haben eigene Systeme entwickelt - teils weil sie schon vor 2021 digital waren, teils weil sie mehr Kontrolle wollten. Das führt zu einem Problem: Wer in Berlin baut, nutzt ein anderes Portal als jemand in Bayern. Planer, die in mehreren Bundesländern arbeiten, müssen sich auf mehrere Systeme einstellen. Das ist zeitaufwendig und teuer.
Der größte Vorreiter ist Baden-Württemberg. Hier sind 96,2 Prozent aller Baurechtsbehörden an das digitale System angeschlossen - das ist mehr als in jedem anderen Bundesland. Bald könnte es das erste Bundesland sein, das flächendeckend digital baut. In anderen Ländern sieht es anders aus: In Sachsen-Anhalt oder dem Saarland sind nur wenige Kommunen online. Die Lücke zwischen Landesebene und Kommunen ist riesig. Die Technik steht - aber die Kommunen haben nicht genug Personal, Geld oder Know-how, um sie zu nutzen.

Wie sieht die Praxis für Bauherr*innen und Planer*innen aus?
Wenn du in Baden-Württemberg einen Antrag stellst, läuft es fast wie bei einem Online-Banking-Portal. Du lädst deine CAD-Pläne hoch, füllst die Formulare aus, und die Behörde antwortet innerhalb von Tagen. Viele Planer berichten, dass sie ihre Software direkt mit dem Portal verbinden können - kein manuelles Kopieren, kein Umformatieren. Die Bearbeitungszeit sinkt um bis zu 30 Prozent.
Anders in Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Dort musst du oft zwei Wege gehen: Einen digitalen Antrag für die Landesbehörde - und einen Papierantrag für die Kommune. Das ist doppelte Arbeit. Ein Architekt aus Stuttgart berichtete auf einem Fachforum: „Ich habe letzte Woche für ein Projekt in Brandenburg 14 Tage gebraucht, nur weil die Gemeinde kein digitales System hat. In BW hätte ich das in drei Tagen erledigt.“
Die Einarbeitung ist kein Kinderspiel. Für professionelle Nutzer wie Architekten oder Ingenieure braucht man 8 bis 10 Stunden, um den XBau-Standard und das Portal zu verstehen. Für Privatpersonen sind es 15 bis 20 Stunden - das ist eine hohe Hürde. Die offizielle Website digitale-baugenehmigung.de bietet 176 Seiten Dokumentation, 42 Mustervorlagen und 28 Video-Tutorials. Aber wer hat schon Zeit, das alles zu lernen? Viele Bauherr*innen lassen sich deshalb von Planern unterstützen - was die Kosten erhöht.
Was kostet die Digitalisierung - und wer zahlt?
Die Technik ist nicht kostenlos. Jede einzelne Bauaufsichtsbehörde, die sich anschließen will, muss mit durchschnittlich 42.500 Euro rechnen - das ist die Kostenpauschale für Anbindung, Schulung und Integration in bestehende Systeme. Die Implementierung dauert 3 bis 6 Monate. Die größte Hürde? Nicht die Technik, sondern die Schulung des Personals. Laut einer Umfrage des Deutschen Städtetages aus März 2025 geben 78 Prozent der Kommunen an, dass das Personal nicht ausreichend geschult ist. Viele Mitarbeiter in den Bauämtern sind über 50, haben kaum Erfahrung mit digitalen Systemen - und bekommen kaum Zeit, sich einzuarbeiten.
Das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen fördert die Digitalisierung mit Mitteln aus dem OZG-Fonds, aber die Kommunen müssen selbst die Umsetzung stemmen. Kleine Gemeinden mit nur einem oder zwei Mitarbeitern im Bauamt sind oft überfordert. Deshalb prognostiziert das Ministerium: Bis 2027 könnten bis zu 15 Prozent der kleineren Kommunen noch keine digitale Lösung anbieten. Das bedeutet: Eine zweigeteilte Verwaltungswelt - digital in den Städten, analog auf dem Land.
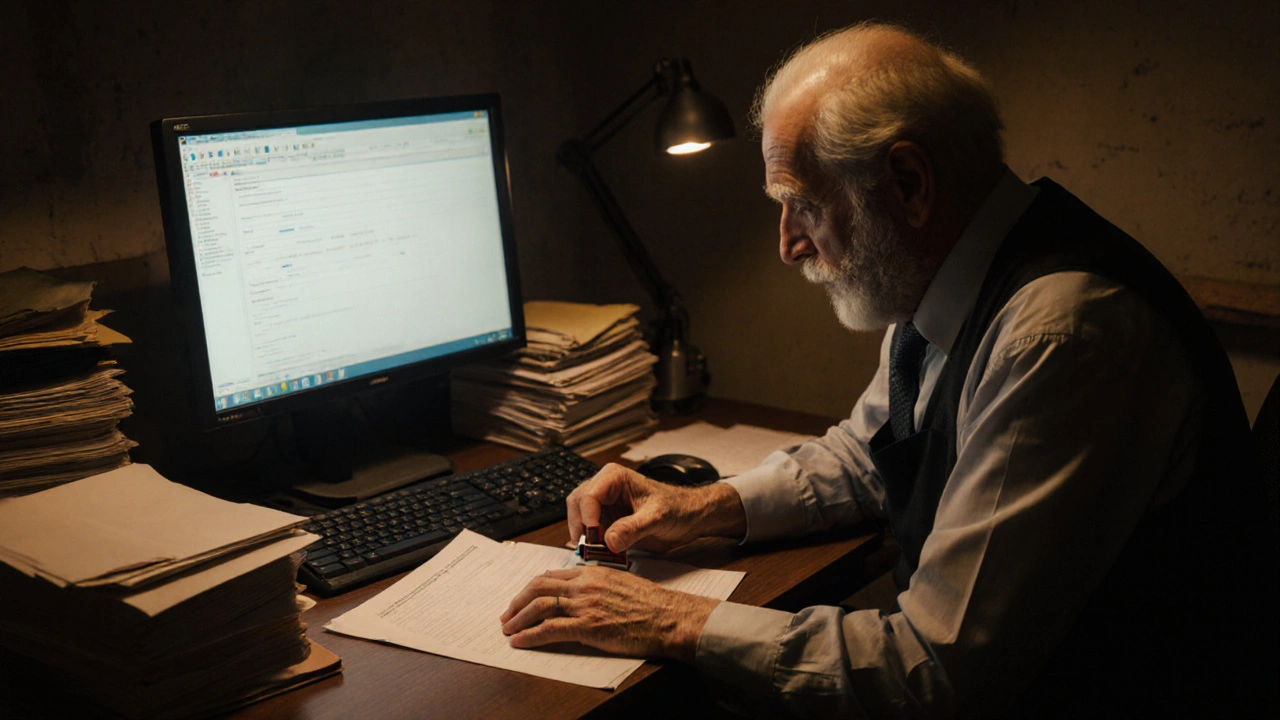
Was kommt 2025 und danach?
Die Entwicklung geht weiter. Seit 1. Juli 2025 gibt es in allen EfA-Ländern den digitalen Bauvorbescheid - eine vorläufige Genehmigung, die du schon vor dem endgültigen Antrag beantragen kannst. Das spart Monate bei der Planung. Ab September 2025 wird Baden-Württemberg KI-gestützte Prüfungen testen: Für Standardbauten wie Einfamilienhäuser oder Carports soll die Software den Antrag automatisch prüfen - ohne menschliche Bearbeitung. Das ist ein großer Schritt. Wenn es funktioniert, wird es sich in ganz Deutschland verbreiten.
Bis Ende 2025 sollen 12 weitere Onlinedienste hinzukommen: digitale Bauabnahme, Flächenmanagement, Baustellenmeldungen und mehr. Langfristig soll bis 2030 alles digital laufen - so die Vision. Aber Experten warnen: „Die technische Basis wird einheitlicher, aber die landesrechtlichen Unterschiede bleiben“, sagt Prof. Dr. Fauth von der TU München. Die 278 verschiedenen Bauordnungen der Bundesländer lassen sich nicht einfach abschaffen. Jedes Land hat andere Vorgaben für Abstände, Dachneigungen oder Lärmschutz. Das bleibt komplex.
Was bedeutet das für dich?
Wenn du 2025 bauen willst, musst du zuerst prüfen: In welchem Bundesland? In welcher Kommune? Die Antwort bestimmt, ob du mit einem Klick starten kannst - oder mit Stapeln Papier. Hier ist dein praktischer Leitfaden:
- Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein: Du bist gut beraten. Nutze das digitale Portal. Lade deine Pläne als XBau-Datei hoch. Die meisten Behörden sind online.
- Sachsen, Sachsen-Anhalt, Saarland, Thüringen: Prüfe genau, ob deine Gemeinde digital ist. Wenn nicht: Bereite dich auf Papier vor. Frag vorher beim Bauamt nach.
- Berlin, Brandenburg, Hessen: Du nutzt ein eigenes System. Suche auf der Website deiner Stadt nach „digitale Baugenehmigung“ oder „Bauantrag online“. Die Oberflächen sind anders - aber oft gut strukturiert.
- Alle anderen: Nutze die Dokumentation auf digitale-baugenehmigung.de. Die 28 Video-Tutorials helfen dir, den XBau-Standard zu verstehen. Und: Lass dich von einem Planer unterstützen - das lohnt sich.
Der digitale Bauantrag ist kein Wundermittel - aber er ist der richtige Weg. Die Zeit, in der du einen Antrag per Post schickst, ist vorbei. Die Frage ist nicht, ob du digital bauen wirst - sondern wann und wie gut.
Kann ich den digitalen Bauantrag auch für kleine Bauvorhaben nutzen?
Ja, der digitale Bauantrag ist nicht nur für große Projekte gedacht. Er gilt für alle Bauvorhaben, die eine Baugenehmigung erfordern - egal ob Einfamilienhaus, Anbau, Garagenumbau oder Dachaufstockung. In Ländern mit vollständiger Digitalisierung wie Baden-Württemberg kannst du sogar für kleine Bauten den digitalen Bauvorbescheid nutzen, um deine Planung zu sichern, bevor du endgültig loslegst.
Was ist der XBau-Standard und warum ist er wichtig?
XBau ist der bundesweit einheitliche Datenstandard für den digitalen Austausch von Bauplänen und Antragsunterlagen. Er definiert, wie Dateien strukturiert werden - also welche Felder enthalten sein müssen, wie Zeichnungen benannt werden und welche technischen Angaben nötig sind. Ohne XBau kann dein Antrag in anderen Bundesländern nicht verarbeitet werden. Planer nutzen CAD-Software, die XBau exportieren kann - das spart Zeit und Fehler.
Warum funktioniert der digitale Bauantrag nicht überall gleich?
Weil jedes Bundesland eigene Bauordnungen hat. In Bayern sind die Abstandsregeln anders als in Hamburg, in Sachsen gelten andere Vorgaben für Dachformen. Diese rechtlichen Unterschiede lassen sich nicht einfach abschaffen. Die zentrale EfA-Lösung kann das, aber sie muss für jedes Land individuell angepasst werden. Das dauert Zeit - und nicht alle Kommunen haben die Ressourcen dafür.
Kann ich meinen Antrag mit meiner bestehenden CAD-Software einreichen?
Ja - aber nur, wenn deine Software XBau unterstützt. Die meisten modernen CAD-Programme wie AutoCAD, Allplan oder ArchiCAD bieten XBau-Export an. Prüfe in den Export-Optionen nach „XBau“ oder „Bauantrag digital“. Wenn du das nicht findest, musst du deine Pläne manuell umwandeln - das ist aufwendig. Einige Planer nutzen spezielle Konverter-Tools, die das automatisch machen.
Wie lange dauert ein digitaler Bauantrag im Vergleich zum Papierantrag?
In digitalisierten Gebieten wie Baden-Württemberg oder Nordrhein-Westfalen dauert die Bearbeitung im Durchschnitt 30 Prozent kürzer - also etwa 6 bis 8 Wochen statt 10 bis 12 Wochen. Das liegt an schnellerer Kommunikation, automatisierten Prüfungen und weniger Fehlern. In Regionen ohne digitale Anbindung bleibt die Dauer gleich wie beim Papierantrag - oder wird sogar länger, weil du zwei Systeme bedienen musst.

